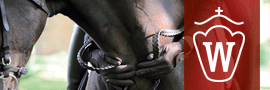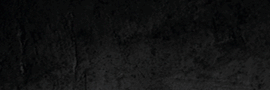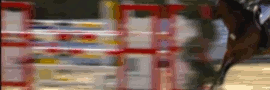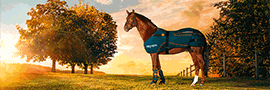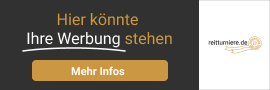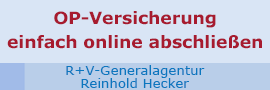Foto: Monika Elmer, Schweiz Richterin FEI Disziplin Springen - Fotograf: R-Haltenswert
Der Pferdesport steht vor großen Fragen – und vor der Verantwortung, Antworten zu finden. Was braucht es, damit Pferde fair behandelt und ehrlich beurteilt werden? Wo verlaufen die Grenzen zwischen sinnvollem Einsatz von Ausrüstung und fragwürdiger Einflussnahme? Und wie schaffen wir echte Veränderung – ohne Spaltung, sondern im Dialog?
Im Gespräch mit Monika Elmer, internationale FEI-Richterin aus der Schweiz, geht es um Regeln, Grauzonen und klare Haltung. Sie spricht offen über Verantwortung, Emotionen – und über das, was uns alle verbindet: die Liebe zum Pferd.
------
V.A.
Als Offizielle stehen sie hinter dem Pferdesport. Was gibt ihnen dazu die Motivation?
M.E.:
In erster Linie ist es meine Leidenschaft für das Pferd – und natürlich auch die Liebe zum Sport.
Die Zeit auf dem Turnierplatz ist – für uns Offizielle wie auch für den Großteil der Reitenden und Pferde – nur ein sehr kleiner Teil im Vergleich zu den vielen Stunden, die sonst mit den Pferden verbracht werden.
Diese gemeinsamen Stunden sind erfüllend: Die Pferde werden gehegt, gepflegt – und ich bin überzeugt, auch geliebt. Viele Sportpferde führen ein echtes Luxusleben. Es ist dabei nur die Kunst zu erkennen, was der Mensch unter „Luxus“ versteht – und was wirklich den Bedürfnissen des Pferdes entspricht.
Ich sehe sehr viele schöne Ritte – etwa kürzlich beim Jagdspringen in La Baule: ein Siegesritt, bei dem Vertrauen, Stil, Balance, Kraft und Ausdauer auf ganz natürliche Weise sichtbar wurden. Gänsehaut-Momente!
Für solche Momente stehe ich auf dem Richterturm. Das ist meine Motivation.
------
V.A.:
Welche Regelung zu Gebissen gilt derzeit bei internationalen Turnieren?
M. E.:
Die FEI-Regelungen zu Gebissen sind aktuell sehr offen gefasst.
Es gibt nur wenige Einschränkungen – etwa bei zusätzlich angebrachten Elementen, bei Veränderungen des Originals oder bei bestimmten Kombinationen. Einige dieser Regeln gelten allerdings ausschließlich für Prüfungen in den Pony- und Children-Kategorien (CSI(O)P und CSI(O)Ch).
Für alle anderen Prüfungen bestehen keine allgemeinen Beschränkungen bezüglich Gebissarten oder Nasenriemen.
Die Jury darf lediglich auf tierärztliche Empfehlung hin die Verwendung eines bestimmten Gebisses untersagen, wenn es zu Verletzungen führen könnte.
Einzelne Nationen sind hier bereits weiter: Sie haben deutlich klarere und strengere Regelungen, was ich sehr begrüße.
------
V.A.:
Gäbe es nicht die Möglichkeit die Gebisse auf drei Varianten zu beschränken, beispielsweise Wassertrense/Olivenkopftrense/Springpelham mit entsprechender Gebissmindeststärke?
M.E.:
Eine Beschränkung auf nur drei Gebissarten – wie Wassertrense, Olivenkopftrense und Springpelham – klingt im ersten Moment sinnvoll. Aber aus meiner Sicht wäre das bei der heutigen Vielfalt an Gebissen zu restriktiv. Viele der Trensen-Varianten haben durchaus ihre Berechtigung – vorausgesetzt, sie werden mit einer feinen Hand und korrekter Einwirkung eingesetzt.
Gleichzeitig sehe ich mit Sorge, wie groß und unübersichtlich der Markt für Zäumungen geworden ist. Es gibt Produkte, bei denen selbst erfahrene Reiter oder Offizielle nicht genau wissen, wie sie korrekt wirken – oder ob sie überhaupt pferdefreundlich sind.
Einige Länder haben deshalb bereits konkrete Vorgaben formuliert: Sie regeln z. B. Material, Gebissstärke, Schenkellänge, Ringgrößen oder erlaubte Kombinationen mit Hackamore, Aufziehtrense oder Schlaufzügel.
Manche dieser Kombinationen sind dort gänzlich verboten – was ich persönlich sehr begrüße.
Wichtig wäre, klare Leitlinien mit definierten Eckwerten zu schaffen – und das idealerweise nicht nur im Sportreglement, sondern über tierschutzrechtliche Vorgaben, die weltweit Mindeststandards festlegen.
Doch genau das ist in der FEI schwierig umzusetzen, da hier sehr unterschiedliche Auffassungen aus allen Teilen der Welt aufeinandertreffen – gerade in Bezug auf das Tierwohl.
------
V.A:
Werden beim VetCheck Maulkontrollen durchgeführt? Wenn nicht, wäre das nicht sinnvoll?
M.E.:
Maulkontrollen sind beim VetCheck nicht standardmäßig vorgesehen.
Sollte jedoch ein Verdacht auf Verletzungen bestehen, wird selbstverständlich eingegriffen – ein Tierarzt ist bei internationalen Turnieren immer vor Ort.
Zeigt ein Pferd während des Wettkampfs Blut im Maul, führt das in der Regel zum sofortigen Ausschluss, außer es handelt sich um eine ganz leichte Verletzung (z. B. ein kleines Aufbeißen der Lippe oder Zunge). In jedem Fall folgen tierärztliche Untersuchungen, um die Ursache abzuklären.
------
V.A.:
Wann, wie und warum müssen Nasenbandkontrollen durchgeführt werden?
M.E.:
Ein zu eng verschnalltes Nasenband soll mehr Kontrolle ermöglichen – tatsächlich führt es aber oft zu Verkrampfung, Stress und Verspannungen beim Pferd.
Es mag in der Anwendung einfacher wirken, ist aber auf Dauer nicht pferdefreundlich – und keine nachhaltige Lösung.
Wirkliche Kontrolle entsteht nicht durch Druck, sondern durch Können, Geduld und Einfühlungsvermögen.
Bei internationalen Wettbewerben setzen wir Offiziellen ein von der FEI zugelassenes Messinstrument ein, um die korrekte Verschnallung zu überprüfen.
Das Nasenband muss so eingestellt sein, dass ein Abstand von 1,7 cm zwischen Nasenrücken und Nasenband messbar ist.
Diese Nasenbandkontrolle wird durch die Stewards vor dem Start routinemäßig durchgeführt.
------
V.A.:
Wie ist der Einsatz von Gamaschen derzeit geregelt? Was ist erlaubt, was ist nicht erlaubt?
M.E.:
Für mich ist klar: Gamaschen sollten ausschließlich dem Schutz und der Sicherheit des Pferdes dienen – nicht der Leistungsmanipulation.
Besonders kritisch sehe ich die aktuell noch zulässigen Hinterbeingamaschen. Zwar gibt es im FEI-Reglement klare Vorgaben – insbesondere in den Jungpferdeprüfungen, wo nur Gamaschen mit abgerundetem Innenschutz, max. 16 cm Länge und Klettverschluss erlaubt sind. Andere Verschlüsse wie Haken, Schnallen oder Clips sind dort ausdrücklich verboten.
Bei allen anderen internationalen Springprüfungen stellt sich aber leider genau diese Frage. Doppelschalen-Gamaschen, die den hinteren Teil der Fessel umschließen und 20cm lange, hoch angelegte und eng angezogene Gamaschen sind immer noch zulässig. Die damit erwünschte Veränderung des Sprungablaufs, geht meist zu Lasten der Gesundheit. Warum die FEI diese Form der Manipulation nach wie vor zulässt, ist für mich nicht nachvollziehbar.
Es gibt positive Gegenbeispiele: In einigen Ländern sind nur noch die Jungpferde-Gamaschen mit Velcroverschluss für alle Prüfungen zugelassen – eine zunächst skeptisch aufgenommene Regelung, die inzwischen breit akzeptiert wird. Auch international sehen wir vermehrt Reiter, die bewusst auf tierfreundlichere Ausrüstung setzen.
Solchen Paaren mehr öffentliche Anerkennung und Applaus zu geben wäre ein starkes Signal.
------
V.A.:
Reithalfter, Gamaschen und Sporen führen immer wieder zu hitzigen Debatten. Es kursieren regelmässig schreckliche Bilder in den öffentlichen Medien von Pferden mit aufgesperrten Mäulern und Flanken, welche vom Sporeneinsatz gezeichnet sind oder sein sollen. Was halten Sie davon?
M.E.:
Als Richterin erhalte ich regelmässig Fotos – Momentaufnahmen –, die nur schwer zu beurteilen sind. Zum Glück habe ich meist auch eine Videoaufnahme, sehe die Situation live oder kann vor Ort direkt kontrollieren, was genau passiert ist.
Ich sage ganz klar: Fotos allein sind nicht aussagekräftig. Ich habe Aufnahmen gesehen von Situationen, die angeblich kritikwürdig waren – in Wahrheit aber vorbildlich und pro Pferd gelöst wurden.
Auch Bilder von Pferdeflanken, die vermeintlich vom Einsatz der Sporen gezeichnet sind, werden in sozialen Medien heftig kritisiert. Das ist verständlich – wenn man nur das Bild sieht. Ganz anders sieht es aus, wenn man die Szene als Ganzes beurteilen kann.
Aber: Ja, es gibt Anwendungen und Vorgehensweisen, die nicht toleriert werden dürfen – und die auch sanktioniert werden müssen. Auch mir stockt der Atem, wenn ich schockierende Videoaufnahmen sehe.
Ich begrüsse es, dass sich immer mehr Menschen für das Recht, die Gesundheit und das Wohlergehen der Pferde einsetzen. Aber ich bin grundsätzlich gegen das gezielte Anprangern in sozialen Medien.
Konstruktive Fragen, Gespräche, die Zusammenarbeit mit Tierschutzorganisationen und gemeinsame Lösungen sind der bessere Weg – und letztlich der wirksamere.
Genau deshalb unterstütze ich auch das Vorgehen und die Vision von „R-haltenswert“: weil es um einen verantwortungsvollen und nachhaltigen Pferdesport geht, bei dem das Pferd im Mittelpunkt steht.
------
V.A.:
Sind die Kontrollen in Bezug auf Qualität und Quantität ausreichend?
M.E.:
Ich erlebe die Offiziellen als echte „Pferde-Menschen“ – bei ihnen steht das Wohl der Pferde an erster Stelle.
Aus meiner Sicht sind die Kontrollen sowohl in ihrer Häufigkeit als auch in ihrer Qualität ausreichend.
Aber: Wir können nur das kontrollieren, was im Reglement vorgesehen ist. Wenn etwas zulässig ist, auch wenn es vielleicht kritisch erscheint, dürfen wir es nicht einfach beanstanden. Unsere Aufgabe ist es, sicherzustellen, dass das bestehende Regelwerk eingehalten wird – nicht mehr, aber auch nicht weniger.
------
V.A.:
Für einige Springprüfungen sind sehr hohe Geldsummen ausgeschrieben. Verleiten diese nicht, auch mal Methoden anzuwenden, die in der Grauzone liegen oder sogar verboten sind?
M.E:
Leider ja. Die Aussicht auf ein hohes Preisgeld kann durchaus dazu verleiten, die Toleranzgrenze etwas höher zu setzen.
Stehen die Pferde nicht im eigenen Besitz, ist der Druck auf die Reitenden oft noch grösser. Die Erwartungen der Pferdebesitzer sind sehr unterschiedlich – das reicht vom wirklichen Pferdekenner und -liebhaber bis hin zu rein kommerziellem Interesse.
Dazu kommt das Verlangen nach Prestige und Ansehen, sowohl bei Reitenden als auch bei Besitzenden. Die Investitionen an Zeit und Geld sind riesig – und damit entstehen Erwartungen an das Pferd, die oft nicht mehr seinem Wesen oder seinen Möglichkeiten entsprechen.
Gefährlich wird es dann, wenn aus einem mittelmässigen Athleten ein Top-Athlet gemacht werden soll – um jeden Preis.
Nur wer dem Pferd die nötige Zeit gibt, seine Grenzen und Fähigkeiten richtig einschätzen und akzeptieren kann, und wer das Pferd um seiner selbst willen liebt – und nicht nur wegen seiner Leistung –, ist für mich ein echter Pferdeliebhaber.
------
V.A.:
Wäre es möglich eine Beschränkung der Anzahl der Starts/der Veranstaltungen einzuführen pro Pferd und pro Jahr? Ist so etwas im Gespräch?
M.E.:
Ja, das ist ein Thema, das zunehmend diskutiert wird – und das durchaus geregelt werden sollte.
Die Anzahl der Starts, die Häufigkeit der Einsätze und auch die Reisezeiten, sei es auf der Straße oder im Flugzeug, sind wichtige Punkte, wenn es um das Wohlergehen der Pferde geht.
National sind die Distanzen oft noch überschaubar – viele Pferde sind nach einem regionalen Turnier am Abend wieder zu Hause im eigenen Stall. Aber international sieht das ganz anders aus.
Es wäre daher dringend notwendig, eine klare Start- und Belastungsbegrenzung einzuführen – und zwar einheitlich, national wie international.
Der Impuls dafür müsste allerdings von der FEI ausgehen, damit solche Regelungen auch weltweit für alle Nationen und Disziplinen gelten.
------
V:A.:
Vielen Dank, Monika Elmer, für das offene Gespräch und Ihre spürbare Verbundenheit mit dem Pferd. Ihre Haltung macht Mut – und bestärkt den Weg von R-haltenswert, gemeinsam für einen fairen, transparenten und pferdegerechten Sport einzustehen.
Quelle: R-HALTENSWERT