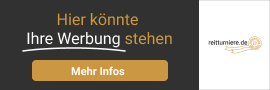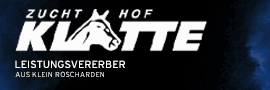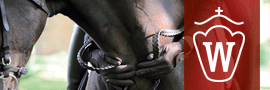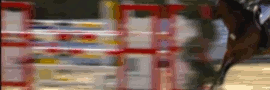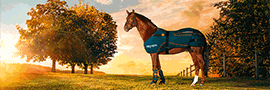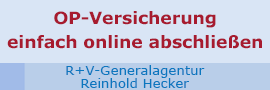Foto: Pferdeosteopathie - Fotograf: JM Fotografie - Fotolia
Fesselträgerschäden - Richtig füttern bei Fesselträgerschaden
Die Diagnose Sehnen-, insbesondere Fesselträgerschaden gilt als das Schreckgespenst unter den Pferdehaltern.
Experten uneinig – Muskel oder Sehne?
Offensichtlich ist sich die Wissenschaft noch nicht ganz einig darüber, ob der Fesselträger nun ein Muskel oder eher ein Band ist. Beim jungen Pferd enthält der Fesselträger vereinzelt Muskelfasern. Erst mit dem Alter, der Belastung und abhängig vom der Rasse bzw. dem Blutanteil wird er zur Sehne und enthält weniger bis keine Muskelfasern mehr. So wäre der Anteil an Muskelfasern besonders hoch bei Vollblütern, Ponies und die wenigsten Muskelfasern findet man bei trainierten Warmblütern. Je höher der Anteil an Muskelfasern ist, desto eher kommt es zu einer Schädigung des Fesselträgers, der in seiner Struktur eine passive Stehvorrichtung darstellt um ein ermüdungsfreies Stehen bei ständiger Fluchtbereitschaft zu bieten (Lutz, R.; Dissertation; Leipzig, 2011).
Langsame Heilung durch Nährstoffmängel zusätzlich verzögert
Dass Sehnen- bzw. Fesselträgerschäden im Vergleich zu Wunden oder Verletzungen extrem langsam abheilen bzw. teilweise als unheilbar gelten ist hochbekannt. Das liegt einerseits an dem Aufbau des Gewebes und andererseits an einer Tatsache, die eigentlich mittlerweile auch zu den entsprechenden Therapeuten durchgedrungen sein müsste: die mangelhafte Ernährungssituation unserer heutigen Pferde, die zwar ausreichend mit energieliefernden Nährstoffen versorgt sind, aber im Mikronährstoffbereich immer noch stark Defizite aufweisen. Der tägliche Nährstoffbedarf wird durch die tägliche Nährstoffaufnahme nicht gedeckt. Die Ernährung ist sozusagen nicht bilanziert. Das trifft im Fall von Sehnenproblemen insbesondere auf junge Pferde, Sportpferde oder Kleinpferderassen zu.
Die Histologie (Wissenschaft vom biologischen Gewebe) gibt uns Aufschluss über die Entwicklungsprozesse im Sehnengewebe und die Ernährung desselben. Dass es sich hier um ein durchblutungs- und zellarmes Gewebe handelt, in dem wenige Zellen in eine Extrazelluläre Matrix eingebettet sind, weiß man bereits vom Gelenksknorpel, von dem man auch lange davon ausging, er könne sich nicht regenerieren.
Sehnen bestehen auch nur aus Wasser
Sehnen und Bänder bestehen überwiegend aus extrazellulärer Matrix sowie aus Sehnenzellen (Tenozyten). Der Anteil dieser Zellen ist sehr gering und ähnlich den Gelenkszellen verändert sich die Sehnenzellen (Tenozyten) im Lauf des Alterns. Die Vorläufer der Sehnenzellen sind die Fibroblasten, die einen wichtige Rolle bei der Heilung spielen, da sie Kollagen und in ihren Membranen (Zellwänden) den Bausteine für Hyaluronsäure bilden. Die Extrazelluläre Matrix besteht wie auch im Knorpel größtenteils aus Wasser. Die weiteren Bestandteile sind die sogenannte Grundsubstanz aus Eiweiß-Zucker-Verbindungen (Proteoglycane), die eine herausragende Stellung im Stoffwechsel der Sehne einnehmen. Sie verfügen nicht nur über ein gewaltiges Wasserbindungsvermögen, sondern sind das Bindeglied zwischen Hyaluronsäure (reine Zuckermoleküle) und Kollagen (Eiweißmoleküle).
Der dritte Hauptbestandteil der Extrazellulären Matrix sind die fasrigen Anteile in Form von Elastin und Kollagen. Im Sehnengewebe ist hauptsächlich das für Form und Festigkeit verantwortliche Kollagen vom sogenannten Typ I zu finden, das sich aus kleinsten Fasern ( Primärfibrillen) Sekundärfasern bildet, die sich dann über Schwefelbrücken zu Tertiärfaserbündel anordnen. Dadurch entsteht eine parallele Ausrichtung, die man so nicht in Bändern oder Knorpeln findet. Bänder und Knorpel erlauben im Vergleich zur Sehne eine mehrdimensionale Beweglichkeit (Lutz, R.; Dissertation; Leipzig, 2011).
Wie baut man ein Haus ohne Bausteine?
Wie man es schon lange vom Knochenstoffwechsel kennt, unterliegt auch das Sehnen- und Bändergewebe einem ständigen Auf- und Abbau. Dabei arbeiten Enzyme, in diesem Fall zinkabhängige Matrix-Metalloproteinasen (MMPs) am Ab- und Umbau der Extrazellulären Matrix und werden von Gewebs-Inhibitoren (TIMPs) reguliert (Lutz, R.; Dissertation Leipzig, 2011).
Der Aufbau der Proteoglycane und der Hyaluronsäure wird von manganabhängigen Glycosyltransferasen ermöglicht. Diese Enzyme, von denen über 100 verschiedene bereits nachgewiesen wurden, übertragen Zucker und sind so in der Lage Eiweiß-Zucker-Verbindungen (Glykoproteine) aufzubauen. Als besonders bedeutend gilt die Xylosyltransferase, die vorwiegend mangan- aber auch magnesiumabhängig arbeitet. Neben diesem Schlüsselenzym folgt die Galactosyltransferase, die im nächsten Schritt am Aufbau der Proteoglykane beteiligt ist (Kuhn, J.; Dissertation, Bielefeld, 2000). Auch die Galactosyltransferase ist hoch manganabhängig (Lawrence J. Berliner, Shan S. Wong; Biochemistry, 1975, 14 (22), pp 4977–4982).
Das kupferabhängige Metalloenzym Lysyloxidase ist für die Vernetzung von Elastin sowie Kollagen notwendig (Smith-Mungo LI, Kagan HM; Matrix Biol. 1998 Feb;16(7):387-98). Dabei scheint offensichtlich peptidgebundenes Kupfer (eventuell auch als Kupferchelat) die Kollagensynthese mehr anzuregen als Vitamin C.
Eisen hingegen wirkt eher kontraproduktiv durch seine oxidative Wirkung. Antioxidative Nährstoffe verbessern nicht nur die Lebensfähigkeit der Fibroblasten und deren Aktivität die Extrazelluläre Matrix aufzubauen sondern wirken offensichtlich auch eisenchelierend (transportieren Eisen aus dem Medium). Desweiteren sind Kupfer, Zink und Mangan Cofaktoren für die Superoxiddismutase, die eine wichtige antioxidative Wirkung im Rahmen der mitochondrialen Entgiftung und Energiegewinnung spielt. Eine stark antioxidative Wirkung entfalten auch Sekundären Pflanzenstoffe aus Kräutern.
Offensichtlich ist eine Unterstützung der Bildung von Hyaluronsäure im Rahmen des Heilungsprozesses besser als eine zu schnelle Kollagenbildung, da letztere Vernarbungen unterstützt (H.-D. Hoppe, R. Lobmann; Hyaluronsäure – Ihre Bedeutung für die Wundheilung, 2002).
Wissenschaftliche Forschungen an neuen Heilmethoden ohne Ernährungsbezug
Derzeitige Untersuchungen, bei denen verschiedene neue Therapieformen u.a. Stoßwelle, Injektionen mit körperfremde und körpereigenen Stoffen wie Hyaluron, ACell (extrazelluläre Matrix aus der Harnblase von Schweinen), autologem Knochenmark, mit Thrombozyten angereichertem Plasma (PRP) bis hin zu in vitro angezüchteten Stammzellen aus autologem Fettgewebe und Knochenmark wurde ohne die Berücksichtigung des Nährstoffstatus des Pferdes in Bezug auf die oben angesprochenen Nährstoffe als Cofaktoren für die enzymatische Tätigkeit erhoben. Zudem ist es schwierig hier an wirklich aussagekräftige Forschungsarbeiten zu gelangen, auch wenn man hier bei den Herstellern direkt fragt.
Der Pferdebesitzer, der sein Pferd vom Tierarzt untersuchen lässt, bekommt mit Sicherheit eine erstklassige Diagnose, ob durch Palpation, Sonographie oder Szintigraphie. Anschließend wird ihm die Tragweite der Erkrankung und der damit verbundene Krankheitsverlauf inklusive der oft sehr schlechten Prognosen des Fesselträgerschadens erklärt. Dann wird er bezüglich oben genannter kostspieliger Behandlungen ausführlich beraten.
Nährstoffstatus des Pferdes in die Heilungsprognose einbinden
Was dann leider fehlt ist eine Anamnese bezüglich des Nährstoffstatus des Pferdes. Dieser kann durch drei Methoden ermittelt werden. Zum einen eine Blutuntersuchung die jedoch nur dann aussagekräftig ist, wenn mindestens fünf Tage lang keine Extramineralisierung in Form von Müsli, Mineralfutter Co. erfolgt ist. Aufgrund der Homöostase ist auf dem Blutbild ein Mangel erst sehr spät ersichtlich. Die Haarmineral-Analyse ist ein moderneres Verfahren bei dem jedoch auf korrekte Referenzwerte zu achten ist. Ein sicheres Verfahren ist die klassische Futtermittelberechnung. Allerdings sollten zugesetzte anorganische Nährstoffzufuhr anders bewertet werden als organische Nährstoffe. Aber nicht nur ein fütterungsbedingter Mangel führt zu einem schlechten Nährstoffstatus sondern ebenso ein in der Vergangenheit entstandener - nicht gedeckter - erhöhter Nährstoffbedarf.
Dazu ist es wichtig, die pferdeeigenen Historie aufzuklären. Stress, Turnier-, Renneinsatz oder zu frühes Einreiten sowie Fohlengeburten erhöhen den Bedarf an bestimmten Nährstoffen. Dies betrifft vor allem Magnesium zur allgemeinen Entspannung der Muskulatur und der daran angesetzten Sehnen sowie Mangan und Selen. Mangan ist aus dreierlei Gründen wichtig. Als unentbehrlicher Cofaktor der Proteoglykansynthese, der Muskelentspannung und zur Reaktion auf oxidative und entzündliche Prozesse. Erfahrungsgemäß wird neben einem hohen Verbrauch an Mangan auch Kupfer und Zink in Mitleidenschaft gezogen. Im Allgemeinen werden gerade diese Nährstoffe in zu geringer Menge über das Grundfutter zugeführt. Zudem kommt ein erhöhter Bedarf durch die entsprechenden Lebensumstände.
Aus diesem Grunde wäre es sinnvoll, bei medizinischen Schreckensdiagnosen und entsprechenden Behandlungen den Organismus durch eine bedarfsgerechte und gezielt mangelausgleichende Fütterung zu stärken, um den Heilungsverlauf zu optimieren.
Dr. Susanne Weyrauch-Wiegand
dr.WEYRAUCH Kräuterspezialitäten
Dinkelackerring 63
67435 Neustadt an der Weinstrasse
Ortsteil Gimmeldingen
Tel.: 06321-963 963-0 oder 0151-18866439